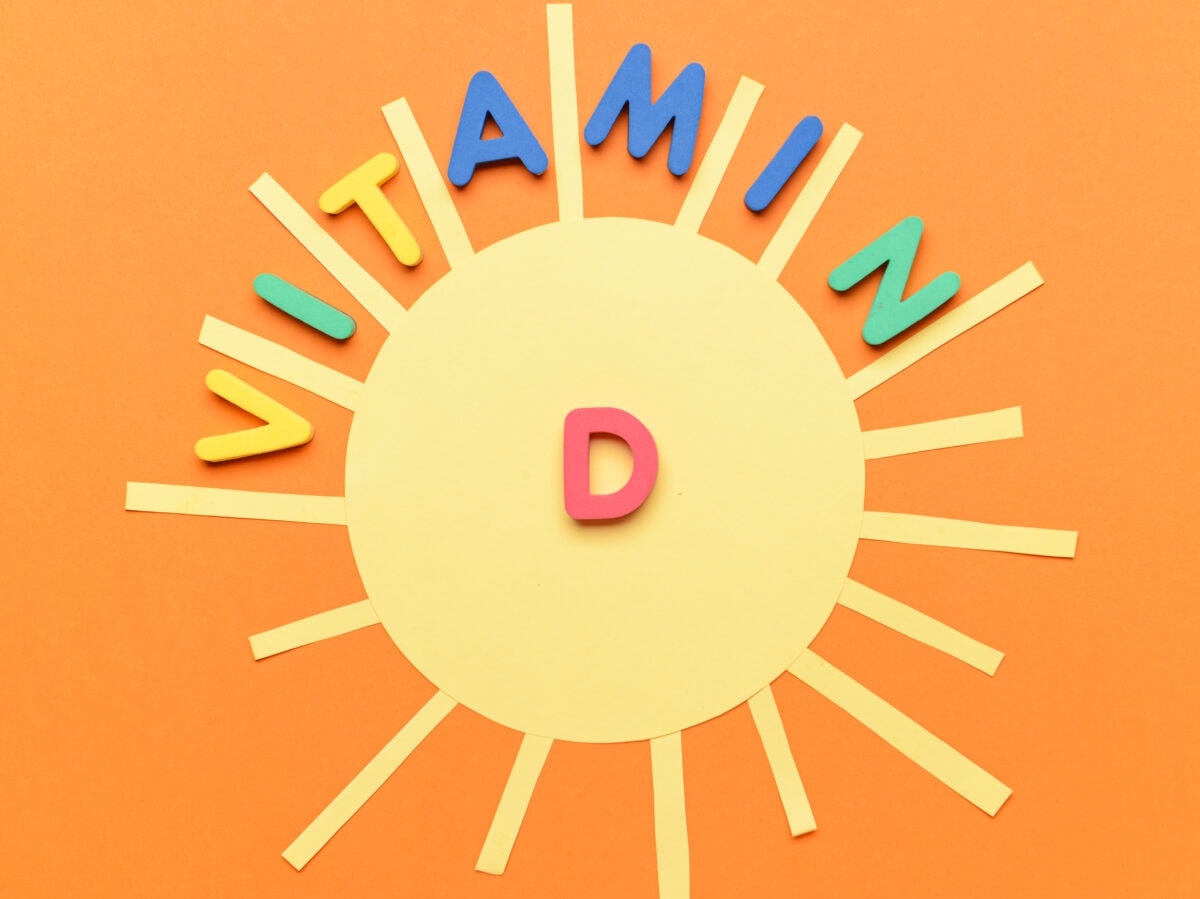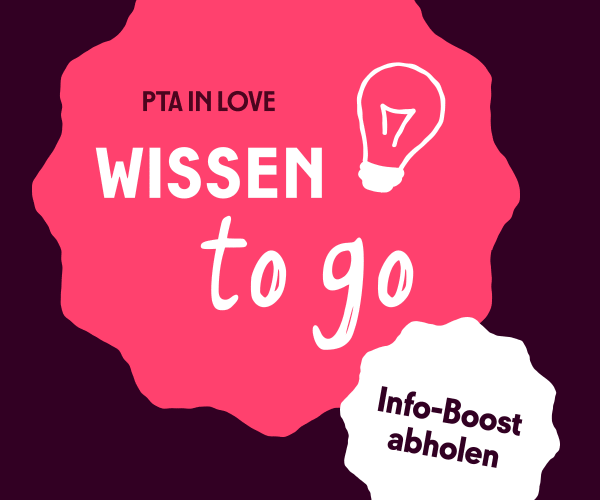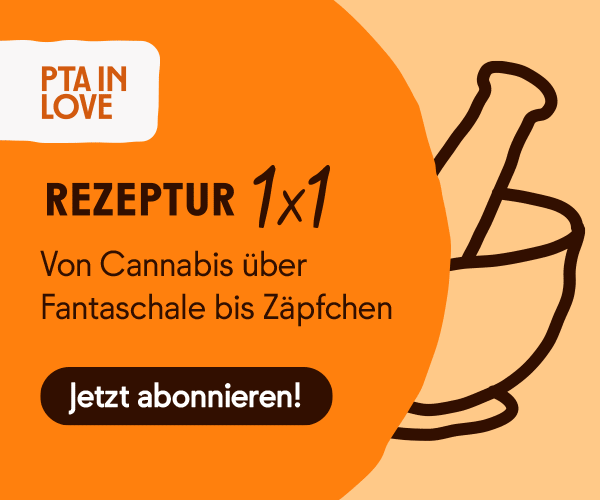Vitamin D schützt nicht vor Knochenbrüchen
Vitamin D wird unter anderem eine wichtige Rolle für die Knochengesundheit zugesprochen. Denn das Sonnenvitamin unterstützt den Einbau von Calcium in die Knochen sowie dessen Freisetzung aus dem Knochengewebe. Aber kann Vitamin D auch Knochenbrüchen vorbeugen? Das zeigt eine Studie von australischen Forschenden, die im Fachmagazin im LANCET erschienen ist.
Vitamin D gilt als Multitalent und wird größtenteils über die Haut gebildet, und zwar bei Sonneneinstrahlung. Fehlt das Sonnenvitamin, kann beispielsweise eine Osteoporose und somit eine Verringerung der Knochendichte die Folge sein. Doch welchen Einfluss hat Vitamin D auf das Risiko für Knochenbrüche? Das wollten Wissenschaftler:innen mehrerer australischer Forschungseinrichtungen herausfinden.
Vitamin D zeigt keinen Effekt auf Knochenbrüche
Dafür haben sie in der doppelblinden, placebokontrollierten Studie rund 21.000 Personen im Alter zwischen 60 und 84 Jahren untersucht. Jeweils die Hälfte von ihnen erhielt ein Placebo oder eine Vitamin D-Supplementierung von 60.000 I.E. pro Monat. In einem Zeitraum von fünf Jahren wurde überprüft, wie oft Knochenbrüche auftraten. Das Ergebnis: In beiden Gruppen erlitten jeweils rund 600 Teilnehmende eine oder mehrere Frakturen. Ein gesteigertes Frakturrisiko unter Einnahme des Sonnenvitamins zeigte sich demnach nicht. Auf der anderen Seite kann Vitamin D jedoch Knochenbrüchen auch nicht vorbeugen. „Es zeigte sich kein Effekt auf das Frakturrisiko“, heißt es von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE).
Eine Einnahme hochdosierter Supplemente, um mit Vitamin D Knochenbrüchen vorzubeugen, ist daher nicht nötig. Im Gegenteil: Eine Supplementation des Sonnenvitamins wird nur empfohlen, wenn ein Mangel – sprich ein Vitamin D-Wert unter 20 ng/ml – nachgewiesen wurde und Ernährung sowie Sonnenbestrahlung das Defizit nicht ausgleichen können. Mehr noch. „Wer hoch dosierte Vitamine einnimmt, ohne dass es nötig ist, riskiert eine Überversorgung und damit unerwünschte Auswirkungen auf die Gesundheit“, warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).
Denn laut den Expert:innen kann eine Überdosierung eine Hyperkalzämie, die von Müdigkeit, Muskelschwäche, Erbrechen, Herzrhythmusstörungen und einer Verkalkung der Gefäße gekennzeichnet ist, die Folge sein. Eine andauernde Hyperkalzämie kann wiederum zu Nierensteinen, Nierenverkalkungen und einer Abnahme der Nierenfunktion führen.
Mehr aus dieser Kategorie
Risiko für Entwicklungsstörungen: Kein Cortison für Schwangere?
Glucocorticoide kommen unter anderem zur Behandlung von Allergien, rheumatischen Krankheiten sowie Autoimmunerkrankungen zum Einsatz. Doch weil durch die Behandlung Entwicklungsstörungen …
Ibuprofen, Paracetamol oder Opioide: Was hilft besser bei Zahnschmerzen?
Der Termin in der Zahnarztpraxis gehört für viele Menschen zu den unangenehmsten Arztbesuchen – erst recht, wenn akute Beschwerden vorliegen. …
PPI: Verminderte Levothyroxin-Aufnahme
Werden Levothyroxin und Protonenpumpenhemmer (PPI) wie Omeprazol und Pantoprazol kombiniert, ist dies nicht ohne Weiteres möglich. Der Grund: Unter PPI …