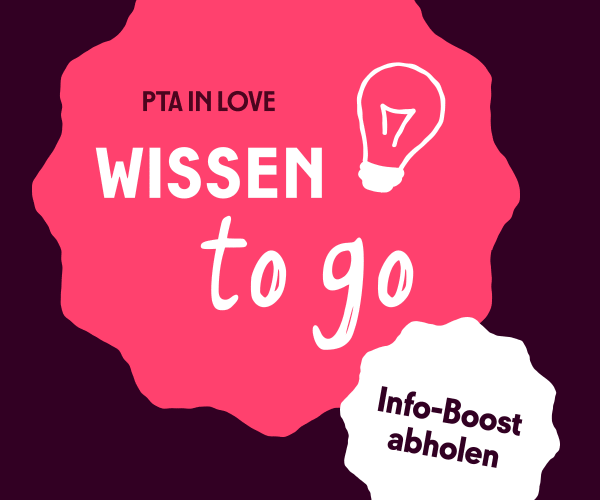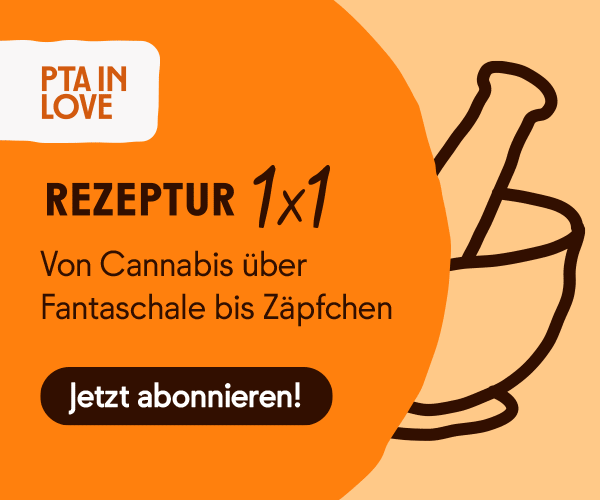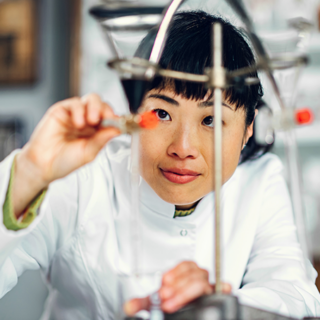Phytotherapie versus Homöopathie: Was sind die Unterschiede?
Hauptsache natürlich? Sowohl Homöopathika als auch pflanzliche Arzneimittel erfreuen sich bei vielen Apothekenkund:innen großer Beliebtheit. Doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen Homöopathie und Phytotherapie? Wir frischen dein Wissen auf.
Sowohl Phytotherapie als auch Homöopathie gehören zu den „Besonderen Therapierichtungen“ gemäß Arzneimittelgesetz (AMG), wie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) informiert. Dennoch gibt es einige Unterschiede. „Phytotherapie sind geprüfte und zugelassene pflanzliche Arzneimittel wohingegen sich die Homöopathie auch chemischer Elemente in schrittweiser verdünnter Form bedient“, heißt es von der Apothekerkammer Niedersachsen. Aber der Reihe nach.
Phytopharmaka: Herstellung, Zulassung und Co.
Für die Herstellung von Phytopharmaka werden Pflanzen oder Pflanzenteile genutzt, beispielsweise Blätter, Wurzeln oder Blüten, die zu Pulvern, Tabletten, Extrakten, Tropfen und Co. verarbeitet werden. Entscheidend ist dabei das Zusammenspiel der verschiedenen enthaltenen Inhaltsstoffe. Apothekenpflichtige Phytopharmaka kommen zur Behandlung und/oder Prävention von Krankheiten zum Einsatz. Sie werden hierzulande als Arzneimittel von der zuständigen Bundesoberbehörde wie dem BfArM zugelassen. Grundlage dafür sind unter anderem Studienergebnisse zu Qualität, Verträglichkeit und Wirksamkeit.
Ein pflanzliches Arzneimittel kann auch als sogenanntes traditionelles Arzneimittel registriert und in Verkehr gebracht werden, wenn aus bibliographischen Angaben über die traditionelle Anwendung oder Berichte von Sachverständigen hervorgeht, dass das Arzneimittel „zum Zeitpunkt der Antragstellung seit mindestens 30 Jahren, davon mindestens 15 Jahre in der Europäischen Union, medizinisch verwendet wird, das Arzneimittel unter den angegebenen Anwendungsbedingungen unschädlich ist und dass die pharmakologischen Wirkungen oder die Wirksamkeit des Arzneimittels auf Grund langjähriger Anwendung und Erfahrung plausibel sind“, heißt es im AMG. Weitere Vorgaben zur Registrierung sind in § 39 a-d AMG geregelt.
In puncto Phytotherapie fasst die Kammer zusammen: „Diese Form der Therapie folgt medizinisch-naturwissenschaftlichen Grundsätzen und ist klar von der Homöopathie abzugrenzen.“
Homöopathie: Nicht alles pflanzlich
Letztere folgt dem Grundsatz „similia similibus curentur“ von Samuel Hahnemann, also „Ähnliches soll mit Ähnlichem geheilt werden“. Grundlage für die Herstellung von Homöopathika ist das Homöopathische Arzneibuch, das Vorschriften zur Prüfung, Lagerung, Abgabe und Bezeichnung sowie zu Qualitätskriterien enthält und Teil des Deutschen Arzneibuchs ist. Generell werden dabei Stoffe oder Stoffgemische verdünnt und verschüttelt (= Potenzierung). § 4 Absatz 26 AMG regelt dazu Folgendes: Ein „Homöopathisches Arzneimittel ist ein Arzneimittel, das nach einem im Europäischen Arzneibuch oder, in Ermangelung dessen, nach einem in den offiziell gebräuchlichen Pharmakopöen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschriebenen homöopathischen Zubereitungsverfahren hergestellt worden ist. Ein homöopathisches Arzneimittel kann auch mehrere Wirkstoffe enthalten.“ Auch bei Homöopathika müssen Qualität und Unbedenklichkeit nachgewiesen werden. Einen Wirknachweis gibt es laut der Kammer jedoch nicht.
Für das Inverkehrbringen bedarf es einer Registrierung bei der zuständigen Bundesoberbehörde. „Homöopathische Arzneimittel können registriert werden, wenn diese Arzneimittel ohne Angabe eines Anwendungsgebietes in den Verkehr gebracht werden sollen, oral oder äußerlich angewendet werden und der homöopathische Ausgangsstoff mindestens um den Faktor 1:10.000 verdünnt ist“, heißt es vom BfArM.
Alternativ kann auch für Homöopathika eine Zulassung beantragt werden. Dafür greifen jedoch spezielle Vorgaben „Homöopathische Arzneimittel können Zulassungen für unterschiedliche Anwendungsgebiete (Indikationen) erhalten. Je nachdem, um welche Anwendungsgebiete es sich dabei handelt, muss auch das Erkenntnismaterial, das im Zusammenhang mit der Zulassung eingereicht wird, entsprechende Voraussetzungen erfüllen“, stellt das BfArM klar.
Das könnte dich auch interessieren
Mehr aus dieser Kategorie
Semaglutid und Co. senken Risiko für Leukämie
Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1)-Rezeptor-Agonisten wie Semaglutid und Liraglutid besitzen eine blutzuckersenkende Wirkung und sorgen für eine mit der Appetitzügelung verbundene Gewichtsregulierung. …
Erhöhtes Sterberisiko bei Mangel an Vitamin D
Besser zu wenig, als zu viel? Über Vitamin D beziehungsweise die Supplementierung des Sonnenvitamins wird immer wieder diskutiert. Doch nicht …
Bakterielle Vaginose: Partnerbehandlung entscheidend
Schätzungsweise jede dritte Frau ist von einer bakteriellen Vaginose betroffen – oftmals wiederkehrend. Um dies zu verhindern, kommt eine Partnerbehandlung …