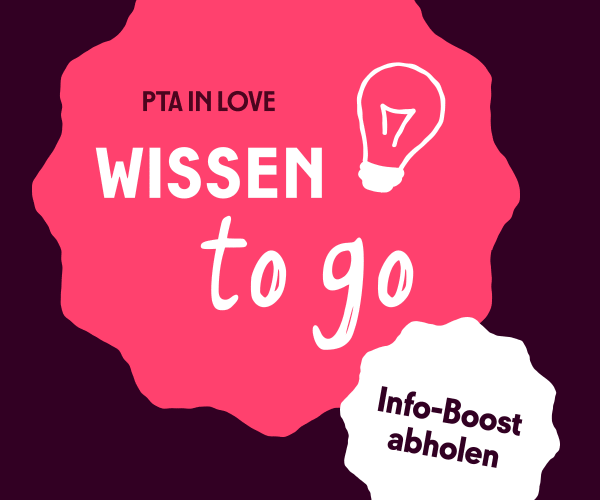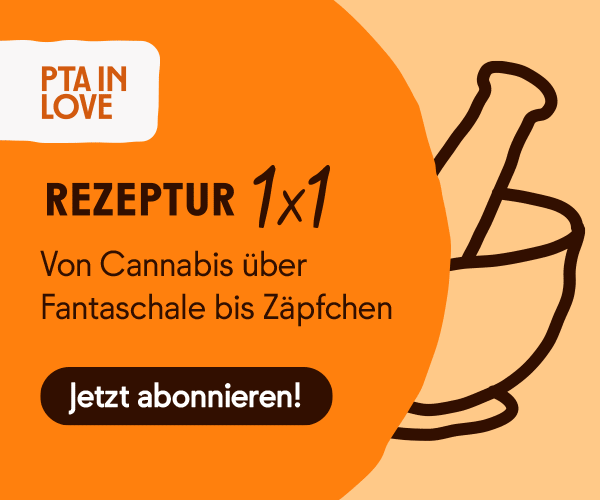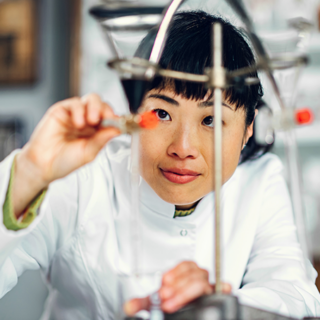Paracetamol-Vergiftung: Was ist zu beachten?
Aktuell sorgt die sogenannte Paracetamol-Challenge in den Sozialen Medien für Wirbel. Doch bei der Einnahme sollten bestimmte Tageshöchstgrenzen nicht überschritten werden. Andernfalls droht eine Überdosierung bis hin zur Paracetamol-Vergiftung.
Paracetamol steht in verschiedenen OTC-Präparaten zur Linderung leichter bis mäßiger Schmerzen und Fieber zur Verfügung. Auch in Erkältungskombis findet der Wirkstoff oft Anwendung. Erwachsene ab 50 kg können als Einzeldosis 500 bis 1.000 mg als Richtwert annehmen. Als Höchstgrenze gelten 4 g Paracetamol/Tag. Für Kinder sind dagegen geringere Obergrenzen zu beachten.
Das Problem: Häufig kommt es zu Überdosierungen – oftmals sogar unbeabsichtigt, beispielsweise wenn zusätzlich zu Mono- noch Kombipräparate angewendet werden, wodurch die Tageshöchstdosis überschritten wird, oder wenn die Einnahme über einen längeren Zeitraum erfolgt. In einigen Fällen kann sich daraus eine Paracetamol-Vergiftung entwickeln.
Paracetamol besitzt analgetische und antipyretische Eigenschaften, wirkt jedoch im Gegensatz zu Ibuprofen kaum entzündungshemmend. Der genaue Wirkmechanismus von Paracetamol ist noch nicht eindeutig geklärt, allerdings wird der antipyretische Effekt auf einen Einfluss auf das Temperaturregulationszentrum im Hypothalamus zurückgeführt. Außerdem bewirkt Paracetamol eine Hemmung der cerebralen Prostaglandinsynthese und hemmt die periphere Prostaglandinsynthese nur schwach. Das Acetamid wird in der Leber metabolisiert.
Entstehung und Symptome einer Paracetamol-Vergiftung
Als potenziell gesundheitsschädlich gelten Tagesdosen zwischen 6 und 8 g. Die Aufnahme von 10 g/Tag kann unbehandelt sogar zum Tod führen. Stichwort Leberversagen. Das Problem: Im Normalfall werden etwa 25 Prozent des aufgenommenen Paracetamols in der Leber metabolisiert und unterliegen dem First-Pass-Effekt. Der Wirkstoff wird dabei mit Glucuronsäure oder Sulfat konjugiert und über die Nieren ausgeschieden. Nur ein kleiner Teil wird über Cytochrom (CYP)-P450-Enzyme in der Leber metabolisiert und es entsteht dabei der reaktive Metabolit N-Acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI) – eine toxische Verbindung.
Kommt es zu einer Überdosierung von Paracetamol, wird ein größerer Teil des aufgenommenen Wirkstoffs über die CYP-Enzyme metabolisiert. Die Folge: Die Produktion von NAPQI steigt und kann nicht mehr neutralisiert werden. Stattdessen bindet dies an Proteine der Hepatozyten und es kommt zum Zelltod.
Während sich eine schleichende Überdosierung erst nach einer gewissen Zeit bemerkbar macht – zunächst durch unspezifische Beschwerden, dann durch erste Anzeichen für eine Störung der Leberfunktion –, sind bei der Aufnahme hoher Dosen Paracetamol die Symptome der Vergiftung in mehreren Stadien zu beobachten:
- Einige Stunden nach der Einnahme können Übelkeit und Erbrechen auftreten, oftmals bleiben Beschwerden jedoch aus.
- Nach 24 bis 48 Stunden zeigen sich meist Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen sowie erste Anzeichen einer Leberfunktionsstörung. Bei einigen Patient:innen kommt es jedoch auch zu einer scheinbaren Besserung der Symptome, wohingegen die entsprechenden Leberwerte wie Transaminasen bereits erhöht sind.
- Drei bis vier Tage nach der Überdosierung kommt es zur Verschlimmerung der bestehenden Beschwerden. Zusätzlich können Gelbsucht, Blutungen, Nierenprobleme und eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse auftreten, weil die Leberwerte signifikant ansteigen.
- Anschließend kommt es zu Anzeichen von Leberversagen und Auswirkungen auf andere Organe.
Paracetamol-Vergiftung: So wird behandelt
Die Behandlung bei einer Paracetamol-Vergiftung erfolgt in der Regel mit N-Acetylcystein. Der Wirkstoff soll als Antidot fungieren, die Toxizität des beim Abbau gebildeten NAPQI eindämmen und Leberschäden verhindern. Dabei ist jedoch der Zeitpunkt der Anwendung entscheidend. Diese sollte so früh wie möglich nach der Überdosierung begonnen werden. Dosiert wird nach Körpergewicht und die Verabreichung erfolgt in der Regel intravenös. Vor allem bei der Aufnahme hoher Dosen kann außerdem Aktivkohle als unmittelbare Behandlungsoption in Betracht gezogen werden, um die Resorption des Wirkstoffes zu verringern.
Hat die Paracetamol-Vergiftung jedoch bereits zu Schäden an der Leber geführt, kann auch eine gezielte Therapie gegen Leberversagen angezeigt sein. Im Ernstfall kann auch eine Transplantation notwendig werden.
Das könnte dich auch interessieren
Mehr aus dieser Kategorie
Migräne wegen schlechter Mundhygiene?
Ob Stress, hormonelle Schwankungen oder bestimmte Lebens- und Genussmittel wie Rotwein – Migräne kann verschiedene Auslöser haben. Dabei spielt offenbar …
Wechseljahre: Besser keine NEM mit Soja-Isoflavonen?
Etwa jede dritte Frau durchlebt die Wechseljahre mit starken Beschwerden wie Hitzewallungen und Co. Neben einer Hormonersatztherapie kommen zur Linderung …
OtriNatural: Haleon erweitert Otriven-Portfolio
Haleon bringt unter der Dachmarke OtriNatural fünf neue Produkte auf den Markt. Dazu gehören unter anderem ein Schnupfenspray, das ohne …