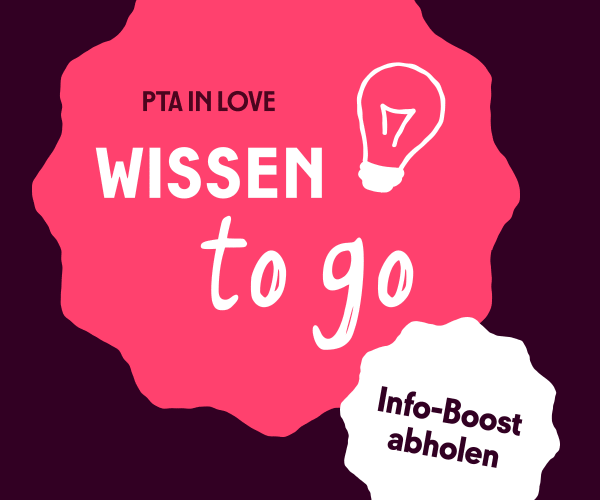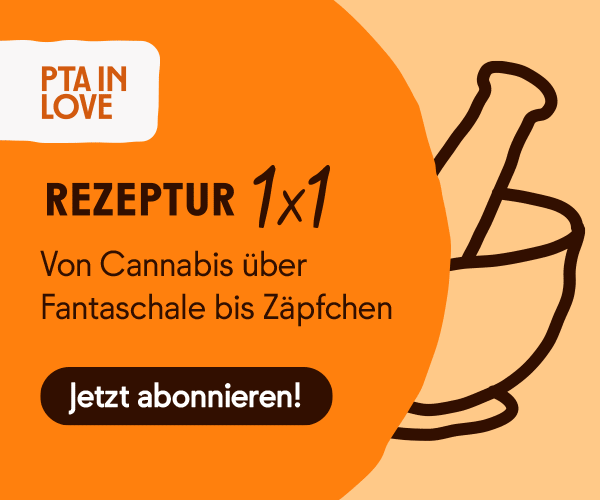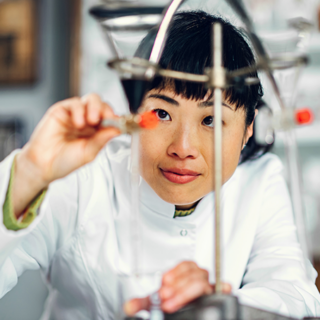Ibuprofen: Falsch-positiver THC-Drogentest
Urinschnelltests kommen unter anderem bei Polizeikontrollen und in Gesundheitsämtern zum Einsatz. Mit weit reichenden Folgen. Denn falsch-positive Testergebnisse sind nicht auszuschließen. So können beispielsweise Arzneimittel zu fehlerhaften Ergebnissen führen und Betroffene in die Bredouille bringen. Beispiele sind Ibuprofen, Methyldopa und Ambroxol.
Im Bulletin für Arzneimittelsicherheit wird darüber informiert, dass die Einnahme von bestimmten Arzneimitteln oder Lebensmitteln falsch-positive Ergebnisse bei Screeningtests bedingen kann. Beispiele sind Mohnsamen, die falsch-positive Ergebnisse beim Schnelltest auf Opioide ergeben können aber auch Pseudoephedrin, trizyklische Antidepressiva und Quetiapin, die falsch-positive Ergebnisse für Amphetamine und Ibuprofen, das falsch-positive Ergebnisse für Marihuana bedingen kann.
Zum Hintergrund: Die immunchemischen Prüfverfahren basieren auf einer Antigen-Antikörper-Reaktion und sind auf die Erfassung eines oder mehrerer Stoffe und/oder deren Metabolite ausgerichtet, heißt es im Bulletin. Für die Tests müssen bestimmte Schwellenwerte (Cut-offs) verwendet werden. Doch dies sind willkürlich festgelegte Grenzwerte, ab wann ein Testergebnis als „positiv“ oder „negativ“ klassifiziert wird. Auch die Sensitivität des Tests kann Einfluss auf das Ergebnis nehmen.
Hinzukommt ein wesentlicher Nachteil von Immunoassays – das Potenzial von Kreuzreaktionen der eingesetzten Antikörper mit anderen Substanzen, die für den Test nicht relevant sind. Dazu gehören Arzneimittel und auch Lebensmittel. Besonders betroffen sind laut Expert:innen Testungen auf ganze Substanzklassen wie beispielsweise Amphetamine und Benzodiazepine. Bei der Testauswertung müssen daher Kreuzreaktionslisten für das verwendete Immunoassay-Testsystem berücksichtigt werden.
| Urinschnelltest auf | Falsch-positive Ergebnisse möglich durch (Beispiele) |
| Amphetamine | Bisoprolol, Metoprolol, Moxifloxacin, Ofloxacin, Ranitidin, Sildenafil |
| Barbiturate | Ibuprofen, Naproxen |
| Benzodiazepine | Efavirenz, Fluoxetin, Furosemid |
| LSD | Ambroxol, Fentanyl, Sertralin, Trazodon |
| Tetrahydrocannabinol | Diclofenac, Efavirenz, Ibuprofen, Naproxen, Pantoprazol |
Einen weiteren Fall meldet die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ). Dabei wurde eine 39-Jährige bei einem routinemäßigen Urin-Drogenschnelltest im Rahmen einer amtsärztlichen Untersuchung falsch-positiv auf Amphetamine getestet. Der Grund: Die Frau wird aufgrund einer arteriellen Hypertonie mit Methyldopa (1×1.000 mg), Metoprolol (1×11,88 mg) und L-Thyroxin behandelt. Eine Gaschromatografie zeigte keinen positiven Nachweis auf Amphetamine. Nachdem die Frau Methyldopa abgesetzt hatte, wurde auf ihren Wunsch erneut ein Schnelltest durchgeführt. Dieser fiel negativ aus.
Mehr aus dieser Kategorie
Vancomycin/Clarithromycin: Sterilfiltration aufgehoben
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat die Empfehlung zur Sterilfiltration von Vancomycin und Clarithromycin Dr. Eberth, Pulver zur …
Essen bis zum Sterben: Warnung vor TikTok-Trend Mukbang
Immer wieder gibt es Warnungen vor neuen Challenges in den Sozialen Medien, die für Nachahmer:innen gefährlich enden können. Ein aktuelles …
Mit Tampons: Neue Testmethode auf Gebärmutterkrebs
Pro Jahr erkranken hierzulande mehr als 10.000 Frauen an einem Endometriumkarzinom – auch Gebärmutterkörperkrebs genannt. Je früher dieses entdeckt wird, …