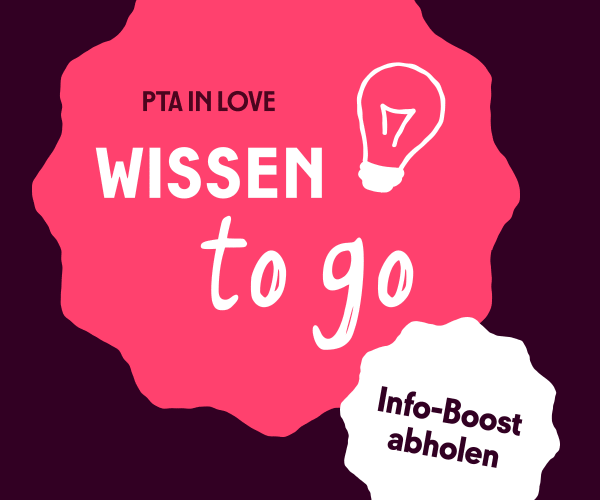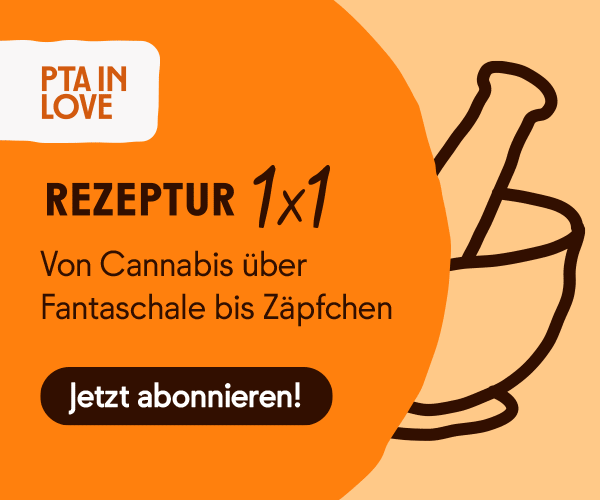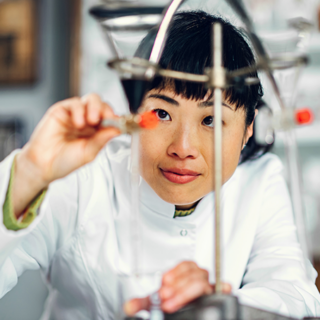Was macht die Delta-Mutation so gefährlich?
Die rasante Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hält uns nicht nur hierzulande in Atem. Bei allem Fortschritt durch die Impfkampagne und weiterhin sinkende Inzidenzwerte wächst die Sorge vor einer vierten Welle. Denn die Delta-Mutation gilt als besonders gefährlich. Warum?
„Die Frage ist nicht ob, sondern wann die Variante-Delta hierzulande dominieren wird“, erklärte Professor Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts bereits Mitte Juni im Rahmen der Bundespressekonferenz. Und er sollte Recht behalten. Denn innerhalb von nur einer Woche hat sich der Anteil der Variante an den Neuinfektionen deutlich erhöht und lag in KW 23 bereits bei 15 Prozent. Das Problem: Delta gilt als ansteckender als Alpha – und verbreitet sich somit noch schneller, vor allem in der ungeimpften Bevölkerung. Der Großteil der Betroffenen, die sich mit der Variante infiziert haben, ist jünger als 60 Jahre. Doch was macht die Delta-Mutation eigentlich so gefährlich?
Wie bei Virusmutationen generell wurde bei der Delta-Variante das Coronavirus so verändert, dass es leichter in die Zellen gelangt. Laut RKI zeichne sich die Mutation „unter anderem durch Aminosäureaustausche im viralen Spike-Protein aus“. Dies führt dazu, dass das Spike-Protein leichter an den Zell-Rezeptor andockt, wodurch wiederum die Übertragbarkeit der Virus-DNA in die Zelle erhöht wird. Daneben wird auch die Immunantwort des Körpers geschwächt, sodass Viruspartikel selbst bei Geimpften oder Genesenen nicht mehr so effektiv von Antikörpern zerstört werden können. Zudem umgeht die Virus-Mutation oftmals die körpereigenen T-Zellen, wodurch sie sich nahezu ungestört weiter verbreiten kann. So entsteht schnell eine hohe Viruslast im Körper und das Ansteckungspotenzial steigt.
Hinzu kommen die meist eher milden Symptome, die die Delta-Mutation besonders gefährlich machen. Wie anhand von Daten aus Großbritannien beobachtet wurde, treten anders als beim Urtyp des Coronavirus sowie anderen Varianten keine „typischen“ Symptome wie ein Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns auf. Stattdessen dominieren Beschwerden wie Schnupfen, Kopf- und Halsschmerzen, die eher einer Erkältung gleichen. Dadurch wissen viele Betroffene zunächst nichts von ihrer Infektion und tragen diese somit oftmals auch an andere Personen weiter.
Die gute Nachricht: „Alle Basismaßnahmen, die wir kennen und beherrschen, sind auch gegen Delta wirksam“, erklärte Wieler in der letzten Bundespressekonferenz. Dazu gehören die AHA+L-Regeln sowie die Kontaktreduktion. Zudem hätten Menschen, die vollständig geimpft sind, einen guten Schutz vor schweren Krankheitsverläufen einer Delta-Infektion. Wie erste Studiendaten zeigen, liegt die Schutzwirkung von Vaxzevria (AstraZeneca) und Comirnaty (BioNTech) nach der zweiten Dosis bei Werten zwischen 60 und knapp 90 Prozent. Nach der ersten Spritze ist dagegen nur ein geringer Schutz zu verzeichnen. Daher appellierte Wieler ebenso wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, sich impfen zu lassen und insbesondere auch die Zweitimpfung wahrzunehmen, um bestmöglich geschützt zu sein.
Das könnte dich auch interessieren
Mehr aus dieser Kategorie
Mit Tampons: Neue Testmethode auf Gebärmutterkrebs
Pro Jahr erkranken hierzulande mehr als 10.000 Frauen an einem Endometriumkarzinom – auch Gebärmutterkörperkrebs genannt. Je früher dieses entdeckt wird, …
Lopedium akut lingual: Schmelztablette bei Durchfall
Flüssiger und breiiger Stuhl sind typische Durchfallsymptome und eine unkomplizierte Diarrhoe in der Regel nach wenigen Tagen wieder überstanden. Doch …
Schwangerschaft: Vitamin D stärkt Knochengesundheit beim Kind über Jahre
Vitamin D reguliert den Calcium- und Phosphathaushalt im Körper und trägt unter anderem zur Gesundheit von Knochen, Zähnen und Muskeln …